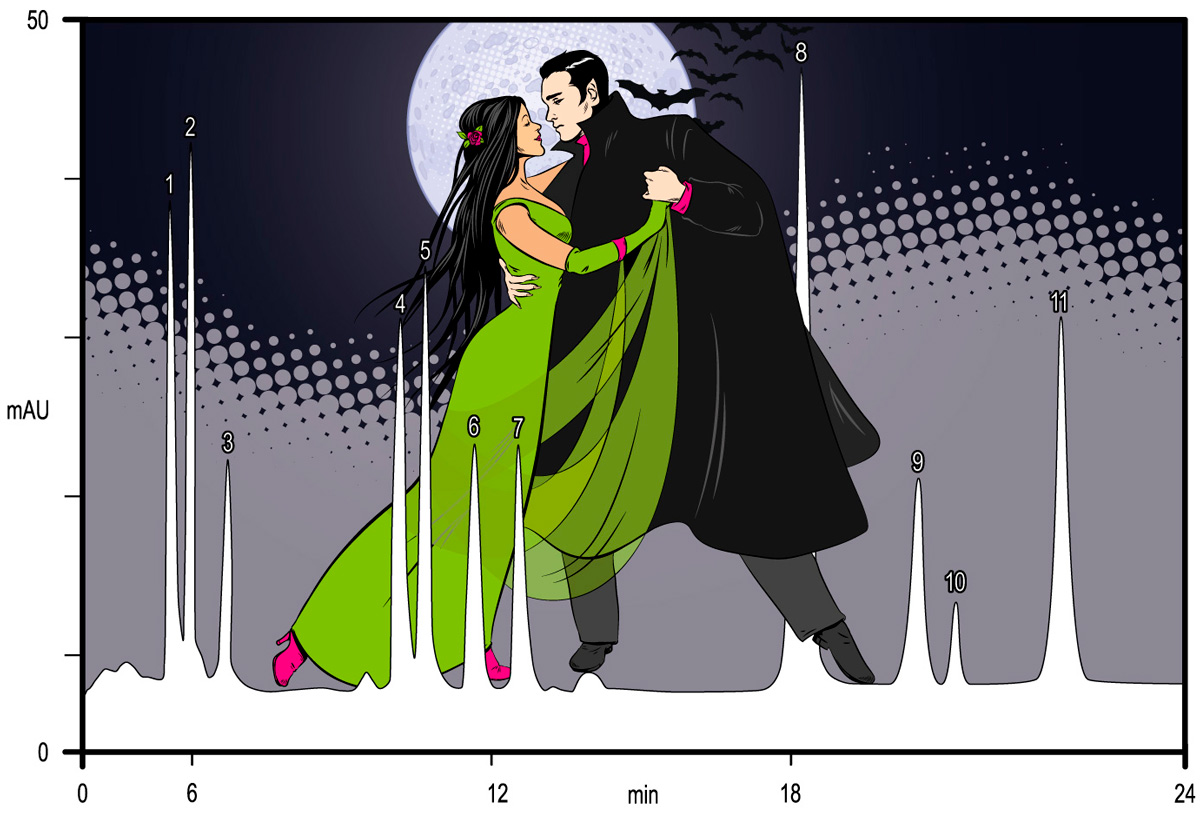Schnee – eine Wissenschaft für sich
Die Einen sehnen sich nach Schnee, während Anderen ihn lieber mit Abstand aus dem Fenster heraus betrachten. Halb Deutschland ist derzeit in eine weiße Schneedecke gehüllt. Mit Schnee legt sich auch immer ein kleiner Zauber über die Welt. Doch hinter diesem Zauber steckt auch ganz viel Physik und Chemie.
Vom Wasser zum Kristall
Bei Schnee handelt es sich um winzige Eiskristalle aus wasserreichen Wolken. Dort lagern sie sich zunächst als Wassermoleküle an kleine Partikel wie Staub oder Meerespartikel an. Bei etwa -20 bis -15 °C bilden sich die Wassermoleküle zu Eiskristallen. Große Eiskristalle können unter der richtigen Luftfeuchtigkeit bis zu 6 mm Durchmesser erreichen. Auf ihren Weg zur Erde gelangen die Eiskristalle verschiedene Luftschichten, sodass sie in wärmeren Schichten schmelzen und auf andere Eiskristalle treffen und sich verhaken. Deshalb entstehen die verschiedenen Arten an Schneeflocken. Die sogenannten Pfannkuchenflocken können bis zu 20 cm groß werden.
Leise rieselt der Schnee
Schneeflocken rieseln sanft zu Boden, weil im Gegensatz zu den Regentropfen, ihre Oberfläche wesentlich größer ist. Deswegen werden Schneeflocken abgebremst und sind damit bis zu 5 Mal langsamer als Regentropfen. Sodass sie langsam zum Erdboden segeln und hüllt ihn in eine weiße Pracht. Wenn der Neuschnee gefallen ist, scheint für uns alles ganz ruhig und leise zu sein. Tatsächlich ist dies nicht nur unser Gefühl, sondern der Schnee dämmt den Schall. Aufgrund seiner lockeren Substanz reflektiert er den Schall sehr wenig, sodass er sich nicht so stark ausbreitet und wir die Ruhe des Schnees genießen können.
Die weiße Pracht
Dass Schnee für uns weiß aussieht, hängt von der Verästelung der Eiskristalle ab. Dadurch reflektieren sich die einfallenden Lichtstrahlen der Umgebung so stark und streuen sie diffus, dass man nicht mehr hindurchschauen kann. Das selbe Phänomen liegt bei gemahlenen Salz vor.
Nichts mehr verpassen
Omnilab Newsletter
Oft hält die schneebedeckte Landschaft nicht lange an. Entweder bildet er sich in Match oder bleibt gar nicht erst liegen. Natürlich lassen Plusgrade den Schnee tauen. Jedoch kommt es oft vor, dass auch an einigen Orten mit gleicher Temperatur der Schnee länger liegen bleibt als an dem anderen. Der Grund liegt in der Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luft sehr trocken ist, dann geht der Schnee direkt vom festen Zustand in den gasförmigen Zustand über. Diesen Vorgang nennt man Sublimieren. Doch der Übergang zu Wasserdampf dauert viel länger als Schmelzen. So können wir den Schnee länger genießen.
Schnee im Labor?
Die Schneeforschung, auch unter dem Namen Nivologie bekannt, resultiert keineswegs aus der Vorliebe zu den Eiskristallen. Vielmehr beschäftigen Schneeforscher sich mit der Verwandlung und der Alterung des Schnees. Wie bilden sich die inneren Strukturen bei Temperaturveränderungen um? Nach welchen Regeln bilden sich die verschiedenen Arten der Eiskristalle in unserer Atmosphäre? Wie können wir Lawinenwarnungen verbessern? Das sind nur einige Fragen die sich Schneeforscher stellen. Geforscht wird natürlich nicht nur am Mikroskop oder mit Computertomografen, sondern auch am „lebenden“ Objekt. Dafür gibt es beispielsweise Schnee- und Lawinenforschungsinstitute in Österreich, Schweiz oder Norwegen. Schneeforschung wird auch aus dem Weltall betrieben. Mit Satellitenforschung wird das Schrumpfen und Wachsen der arktischen Eisflächen beobachtet.
Physikalische und chemische Vorgänge sind der Ursprung der Schneeflocken. Viele von ihnen sind noch nicht vollends wissenschaftlich ergründet, sodass die Nivologie das Wesen der wunderschönen Eiskristalle stetig erforscht.
Weitere Informationen:
In unserem Online Shop finden Sie eine riesige Auswahl an Laborartikeln.
Quellen:
Merkel, W. (2010): Die Wissenschaft vom Schnee, https://www.welt.de/welt_print/wissen/article5889581/Die-Wissenschaft-vom-Schnee.html
MDR Wissen (2017): Die Wissenschaft der weißen Pracht – Wird es wirklich leise, wenn der Schnee fällt? https://www.mdr.de/wissen/umwelt/winter-leise-rieselt-schnee-wissenschaft100.html
Diesen Beitrag teilen:
Ähnliche Beiträge:
März 5, 2024
Schlenk-Line-Experte begeistert von Schraubenpumpe
Dezember 12, 2023
Stetige Weiterentwicklung der regenerativen Medizin bei präziser Temperaturregelung
November 24, 2023
Mikroskopie – oder: Kleinste Welten werden ganz groß!
November 22, 2023
5 Tipps für chemiebeständiges, ölfreies Vakuum