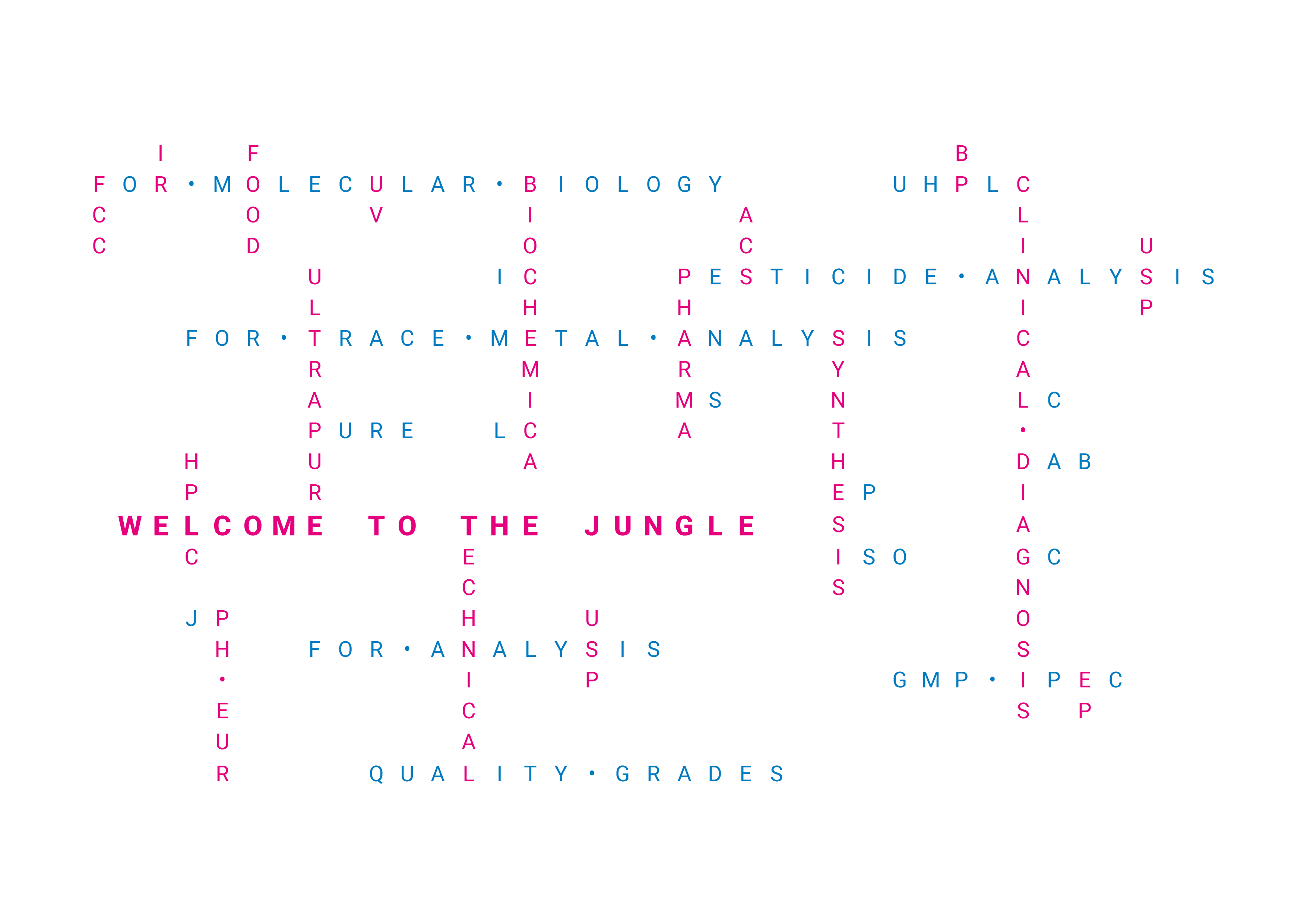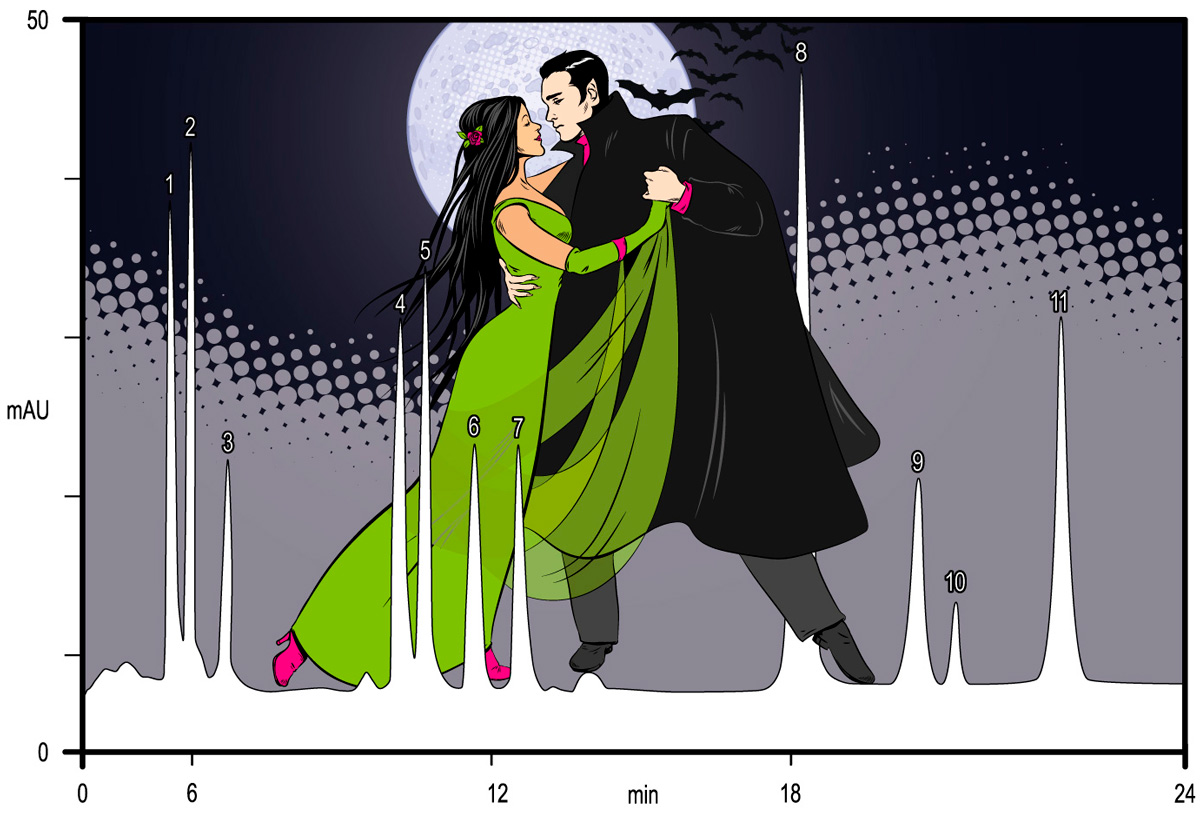Ein Wegweiser durch den Zertifikate-Dschungel
Europa: Eine Welt aus Normen, Regeln und Zertifikaten. Fast alles ist durch eine Norm definiert. Von der Zugkraft, die Zahnbürstenborsten aushalten müssen bis zur sogenannten „Schnullerkettenverordnung“ ist alles vertreten. So absurd einzelne Vorgaben erscheinen, sorgen sie doch für unsere Sicherheit. Auch für im Laborumfeld verwendeten Glasgeräte gibt es mehrere Zertifikate. Sie bescheinigen die Qualität und regeln das Einsatzgebiet verschiedenster Glasgeräte. Das sind die wichtigsten Unterscheidungen, die Sie kennen sollten:

Bild: Glasware und Zertifikate, Quelle: BRAND
Zertifizierte Materialeigenschaften und deren Wichtigkeit
Bei Hohlglasbehältern, wie beispielsweise Flaschen, Bechergläsern, Reaktions- oder Druckbehältern, geht es hauptsächlich um die Materialeigenschaften. Dazu zählen Oberflächengüte, Transmission oder Beständigkeit gegenüber Wasser, Säuren und Laugen. Finden thermische Reaktionen statt, ist die thermische Belastbarkeit und die Schockbeständigkeit sehr wichtig. Wenn das Gefäß nicht die notwendigen Anforderungen erfüllt, besteht das Risiko, dass die Anlage nicht so funktioniert wie geplant. Das gilt auch für die Arbeit mit Exsikkatoren oder anderen Druckbehältern. Eine zertifizierte Prüfung der Oberfläche auf Kratzer oder Kerben erlaubt einen Rückschluss auf die Stabilität bei Vakuum oder Überdruck. Die gesamten Informationen basieren auf den Werkstoffeigenschaften des Glases. Die Einhaltung der jeweils relevanten Normen setzt daher eine hohe Kenntnis des Werkstoffes selbst und seiner Bearbeitung voraus. Im Falle von Vakuum- oder Druckanlagen ist die Bearbeitung des Werkstoffes bedeutend, da die Anschlüsse an die notwendige Geräteperipherie die Dichtigkeit des Systems entscheidend beeinflussen.
Fokus auf Eigenschaften von Justierung und Bedruckung
Beim Blick auf die Volumenmessgeräte verschiebt sich der Fokus auf Eigenschaften wie Justierung und Bedruckung. Wenn es nur um kleinste Volumina geht, macht ein Mikroliter mehr oder weniger einen Unterschied. Zugunsten der Informationen zur Veredlung rücken die Angaben zum Glas als Werkstoff in den Hintergrund, da Volumenmessgeräte während der Anwendung weder Über- oder Unterdrücken noch besonderen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Im Fokus stehen bei den Messgeräten die Art der Volumenjustage und die Methoden der Bedruckung, um eine möglichst lange Haltbarkeit zu gewährleisten.
Sowohl die Fehlergrenzen als auch die wichtigsten Materialeigenschaften von Messkolben, Vollpipetten, Messzylindern, Messpipetten oder Büretten sind für den Hersteller in den entsprechenden DIN EN ISO-Normen geregelt. Nur Geräte mit der höheren Genauigkeitsstufe A erhalten diese Zertifikate. Nicht nur die Fehlergrenzen, sondern auch die verwendeten Geräte sind für die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Anwendung essentiell. In vielen Regelungen wird daher die Rückführbarkeit der Messergebnisse gefordert. Diese Rückführbarkeit ist nur mit einem Zertifikat gegeben, das eine Chargen- oder Seriennummer enthält.
| Werkskalibrierung | Werkskalibrierung | Akkreditiertes Labor | |
|---|---|---|---|
| Chargenzertifikat | Einzelzertifikat | DAkkS-Kalibrierschein | |
| Mittelwert Standardabweichung Chargennummer | Messwert Messunsicherheit Seriennummer | Messwert Messunsicherheit Seriennummer + Jahr und Monat der Ausstellung |
|
Tabelle: Übersicht des Inhalts der Zertifikatsvarianten für Volumenmessgeräte
Die verschiedenen Zertifikat-Typen
Je nach Anforderung müssen im Labor verwendete Messgeräte unterschiedliche Ansprüche erfüllen. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in der Welt der Zertifikate. Hier finden sich unterschiedliche Zertifikate-Typen mit unterschiedlichen Informationen. Es gibt Chargenzertifikate, Einzelzertifikate und DAkkS-Kalibrierscheine. Auf diesen Dokumenten finden sich mindestens folgende Informationen:
- Angabe des Herstellers
- Angabe des Produktes durch Beschreibung oder interne Produktnummer
- Gemessener Volumenwert
- Mess- oder Standardabweichung
Idealerweise finden sich darüber hinaus Angaben zur Messmethode (z.B. DIN EN ISO 4787), um die Werte vergleich- und nachvollziehbar für Hersteller und Anwender zu machen. Werden Volumenmessgeräte in FDA (Food and Drug Administration) – auditierten Prozessen eingesetzt, müssen sie zusätzlich den Vermerk „USP“ tragen. Das amerikanische Pendant zur DIN EN ISO unterscheidet sich zur europäischen Norm hauptsächlich bei Fehlergrenzen und Nennvolumina. Der größte Unterschied zwischen den verschiedenen Zertifikaten liegt in der Anzahl der Geräte, auf die sie sich beziehen. Chargenzertifikate bescheinigen Werte, wie der Name schon sagt, für eine komplette Produktionseinheit. Das angegebene Volumen ist ein Mittelwert, der mit der Standardabweichung angegeben wird. Die aufwendigeren Einzelzertifikate und international besonders anerkannten DAkkS-Kalibrierscheine beziehen sich jeweils auf das einzelne Gerät und bescheinigen individuelle Messwerte und deren Unsicherheiten.
Nichts mehr verpassen
Omnilab Newsletter
Was bringen Zertifikate eigentlich?
Neben der bereits erwähnten Sicherheit und Rückführbarkeit geht es bei Zertifikaten auch um die Optimierung interner Prozesse. So kann die Wareneingangskontrolle entfallen oder größtenteils reduziert werden, da die Messwerte nicht noch einmal kontrolliert werden müssen. Außerdem liefern die Zertifikate Startwerte für die eigene Prüfmittelüberwachung. Auch für die eigentliche Laborarbeit haben Zertifikate entscheidende Vorteile. Wie bei jeder anderen Arbeit auch, gliedern sich die Aufgaben im Labor in Routine- und Spezialtätigkeiten. Für Routineaufgaben sind chargenzertifizierte Geräte absolut ausreichend. Spezialisierte Arbeiten, wie die Validierung von Analysemethoden, müssen mit einzeln zertifizierten Geräten durchgeführt werden, um die festgelegten Fehlertoleranzen im Routinebetrieb nicht zu überschreiten.
Geräte mit DAkkS-Kalibrierschein kommen immer dann zum Einsatz, wenn besonders hochwertige Kalibrierungen, beziehungsweise Kalibrierungen eines akkreditierten Labors erforderlich sind. In diesem Fall bürgt die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) für die zuverlässige Angabe der Messunsicherheit. Durch die verschiedenen Arten von Zertifikaten wird die Überprüfung der Geräte also ihrer Verwendung angepasst. Da Einzelzertifikate aufwendiger und somit kostenintensiver sind, werden sie auch nur für die Produkte ausgestellt, die in entsprechenden Prozessen eingesetzt werden. Geräte für Routinearbeiten werden somit nicht überzertifiziert.

Bild: Wahlmöglichkeit zwischen einer Werkskalibrierung oder DAkkS-Kalibrierung von einem Volumenmessgerät, Quelle: BRAND
Die Zukunft der Zertifikate
Eine erhöhte Notwendigkeit für Risikomanagement und ein wachsender Berg an Informationen, welcher schneller und einfacher zu verarbeiten ist – das ist die Tendenz unserer Arbeitswelt. Somit wird der Stellenwert von Normen und Zertifikaten, auch im Sinne der Standardisierung von Industrie 4.0, weiterhin steigen. Um die Komplexität zu reduzieren, wird sich ihre Erscheinung aber modernisieren und ein schnelleres Verständnis ermöglichen. Trotz ihrer langen Tradition sind auch Glasgeräte von dieser Entwicklung nicht ausgenommen, da sie im Labor nach wie vor nicht wegzudenken sind.
Weitere Informationen
Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung von BRAND– unserem Top-Partner für Volumenmessgeräte aus Glas.
Sie interessieren sich für Produkte von BRAND? Noch bis zum 30. September erhalten Sie den Mehrfachdispenser HandyStep® touch im Set mit Ladeständer und sparen so über 25%. Für mehr Auswahl an Artikeln von BRAND besuchen Sie unseren Online Shop.
Diesen Beitrag teilen:
Ähnliche Beiträge:
April 1, 2024
Reinheit ohne Kompromisse: Einwegprobenehmer in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
März 7, 2024
Welcome to the Jungle – Teil 2: Die Landschaft der Chemikalienqualitäten und -spezifikationen
März 5, 2024
Schlenk-Line-Experte begeistert von Schraubenpumpe
Dezember 12, 2023
Stetige Weiterentwicklung der regenerativen Medizin bei präziser Temperaturregelung